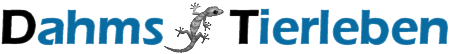Aus der Presse
Meldungen aus Wissenschaft und Forschung
Die Liste enthält Verweise zu interessanten Publikationen rund um die Welt der Tiere und der Evolutionsbiologie. Die Tabelle lässt sich in allen Spalten absteigend und aufsteigend sortieren. Nutzen Sie das Suchfeld, um einen bestimmten Begriff direkt zu finden.
| Datum | Quelle | Thema | Meldung |
|---|---|---|---|
| Datum | Quelle | Thema | Meldung |
| 2026-01-05 | scinexx | Evolution | War Sahelanthropus der erste Vormensch? Neuanalyse von Fossilien klärt Einordnung des sieben Millionen Jahre alten Urzeit-Primaten. Vormensch statt Urzeit-Affe: Der erste echte Vormensch könnte früher entstanden sein als gedacht. Denn schon der vor sieben Millionen Jahren lebende Hominide Sahelanthropus besaß wesentliche Merkmale eines Vormenschen und ging zumindest zeitweise aufrecht, wie Neuanalysen von Sahelanthropus-Fossilien nun nahelegen. Er könnte demnach unser ältester direkter Vorfahre gewesen sein, wie Forschende in "Science Advances" berichten. |
| 2025-11-25 | VBIO | Biologie | Vampire der Tiefsee: Uralte Verbindung zwischen Oktopussen und Tintenfischen Ein "genomisches lebendes Fossil" enthüllt, wie die Kraken und Tintenfische vor mehr als 300 Millionen Jahren entstanden sind. In einer in iScience veröffentlichten Studie präsentieren Forscher*innen um Oleg Simakov von der Universität Wien, des National Institute of Technology – Wakayama College (NITW; Japan) und der Universität Shimane (Japan) das bisher größte sequenzierte Genom eines Kopffüßers. Ihre Analysen zeigen, dass der Vampirtintenfisch Teile einer alten, tintenfischähnlichen Chromosomenstruktur bewahrt hat und belegen damit, dass sich moderne Kraken von tintenfischähnlichen Vorfahren entwickelt haben. |
| 2025-11-11 | scinexx | Biologie | Rätsel um 360-Grad-Blick der Chamäleons gelöst Telefonkabel-Prinzip: Chamäleons können ihre Augen extrem weit verdrehen, was ihnen nahezu einen 360-Grad-Blick ermöglicht. Jetzt enthüllen CT-Scans erstmals, wie diese außergewöhnliche Beweglichkeit zustande kommt. Demnach ähneln die hinter den Augäpfeln liegenden Sehnerven von Chamäleons Telefonkabeln: Sie sind spiralförmig aufgerollt und dadurch zugleich lang und kompakt. Je nach Augenposition wird dieses „Nervenkabel” entsprechend stark gedehnt. Es ist das erste Mal, dass eine solche Augenanatomie bei einer Echse beobachtet wurde. |
| 2025-11-10 | scinexx | Zoologie | Dieser Frosch hat keine Kaulquappen Biologische Rarität: Fast alle Frösche und Kröten entwickeln sich über Kaulquappen. Doch drei neuentdeckte afrikanische Baumkröten verstoßen gegen diese Regel. Diese Kröten überspringen das Laichen und Larvenstadium komplett. Stattdessen bringen ihren Nachwuchs lebend und als voll ausgebildete, winzige Kröten zur Welt, wie Biologen in „Vertebrate Zoology“ berichten. Unter den Amphibien sind diese Baumkröten damit eine absolute Ausnahme. Aber was brachte sie dazu? |
| 2025-10-29 | scinexx | Zoologie | Wie Giftschlangen zubeißen Tödliche Unterschiede: Wenn Giftschlangen zubeißen, nutzen sie unterschiedliche Strategien, wie Highspeed-Videos enthüllen. Demnach sind die Vipern am schnellsten: Sie benötigen teilweise nur 22 Millisekunden für ihren Biss. Giftnattern beißen dafür wiederholt zu und kauen ihr Gift so förmlich aus den Giftdrüsen heraus. Nattern wiederum sind eher langsam, dafür bewegen sie ihre Giftzähne seitlich in der Beute hin und her und hinterlassen so sichelförmige Bissspuren. |
| 2025-10-22 | scinexx | Paläontologie | Einer der ältesten Dinosaurier der Welt entdeckt Urzeitfund im Hochgebirge: In den argentinischen Anden haben Paläontologen ein nahezu vollständiges Skelett eines der ältesten Dinosaurier der Welt entdeckt. Huayracursor jaguensis lebte vor rund 230 Millionen Jahren – zu einer Zeit, als die Herrschaft der Dinosaurier gerade erst begann. Der Fund liefert zugleich Hinweise auf die ersten Schritte jener Entwicklung, die später zu den gigantischen Langhalsdinosauriern führte. |
| 2025-10-21 | scinexx | Paläontologie | Abdrücke des ältesten Säugetiervorfahren entdeckt 2024 haben Paläontologen auf Mallorca das Fossil des ältesten Säugetiervorfahren entdeckt. Jetzt haben sie auch die Fußspuren dieses Gorgonopsiers gefunden. Die 270 Millionen Jahre alten Abdrücke verraten, dass Gang und Haltung dieses urzeitlichen Vierbeiners schon erstaunlich modern und säugetierähnlich waren. Das hundeähnliche Tier lief bereits mit senkrecht unter dem Körper stehenden Beinen und hatte größere Füße als Hände. |
| 2025-10-02 | scinexx | Paläontologie | Fossil ist einzigartige Mischung aus Schlange und Echse Kiefer einer Schlange, Körper eines Warans: In Schottland haben Paläontologen ein bisher einzigartiges Reptilienfossil entdeckt. Das 167 Millionen Jahre alte Fossil besitzt Merkmale von Schlangen, aber auch von Geckoartigen. Damit vermischt dieses Tier verschiedene, nur entfernt verwandte Äste des Reptilienstammbaums. Dies wirft Fragen zur Evolution der Schlangen auf. Handelt es sich um eine Ur-Schlange mit Beinen? Oder haben einige Echsen damals ein schlangenähnliches Gebiss entwickelt? |
| 2025-09-24 | scinexx | Genetik | Wie Wirbeltiere zu ihren Fingern und Zehen kamen Genetisches Recycling: Wir verdanken unsere Finger und Zehen uralten Genen, die es schon bei den Fischen gab. Ein Teil dieser DNA-Abschnitte war ursprünglich jedoch für die Kloake der Fische zuständig, wie nun eine Studie überraschend enthüllt. Demnach recycelten die Wirbeltiere im Zuge ihres Landgangs bestehende regulatorische Genprogramme für andere Körperregionen und funktionierten sie für den neuen Zweck um. |
| 2025-09-24 | VBIO | Biologie | Stadt-Eidechsen sind überraschend gesellig Straßen, Mauern, Beton, die Stadt wirkt wie ein unwirtlicher Lebensraum. Doch manche Tiere kommen erstaunlich gut mit ihr zurecht. Eine neue Studie zeigt: Mauereidechsen (Podarcis muralis) verhalten sich in Städten deutlich geselliger als auf dem Land. Das Forschungsteam um Erstautorin Avery Maune von der Universität Bielefeld untersuchte Populationen in Kroatien, mit überraschendem Ergebnis. |
| 2025-07-31 | scinexx | Biologie | Tiefste Lebensgemeinschaft der Erde entdeckt Spektakulärer Fund: Eine Forschungsexpedition hat riesige Kolonien von Meerestieren am Grund von zwei Tiefseegräben im Pazifik entdeckt. Die dichten Gemeinschaften von Röhrenwürmern, Muscheln und Meeresschnecken reichen bis in 9.533 Meter Tiefe – es sind die tiefsten bisher bekannten tierischen Lebensgemeinschaften, wie das Team in „Nature“ berichtet. Die ausgedehnten Tierkolonien gewinnen ihre Energie aus Methan und Schwefelwasserstoff, die am Grund der Tiefseegräben austreten. Dies wirft ein ganz neues Licht auf das Leben in diesen Tiefen. |
| 2025-07-23 | Informationsdienst Wissenschaft | Paläontologie | Ein fossiler „Wundersaurier“ verändert das Verständnis der Reptilienevolution Körperbedeckungen wie Haare und Federn spielen in der Evolution eine zentrale Rolle. Als komplexe Hautauswüchse ermöglichen sie Warmblütigkeit durch Isolation und erfüllen zugleich Funktionen wie Balz, Wahrnehmung, Abschreckung sowie – bei Vögeln – den Flug. Sie unterscheiden sich deutlich von den einfachen Schuppen der Reptilien. Solche komplexen Hautstrukturen waren bisher nur bei Säugetieren, Vögeln und ihren nächsten fossilen Verwandten – Dinosauriern und Flugsauriern – bekannt. |
| 2025-07-23 | scinexx | Evolution | Kommen Spinnen aus dem Meer? Wasser oder Land? Spinnen und Skorpione sind typische Landbewohner, doch ihr evolutionärer Ursprung könnte im Meer liegen, wie Forschende nun herausgefunden haben. Darauf deutet das 500 Millionen Jahre alte Fossil eines winzigen marinen Gliederfüßers hin, dessen Nervensystem überraschend stark dem moderner Spinnentiere ähnelt. Damit stellt der Winzling die bisherige Lehrmeinung zum Ursprung der Arachniden auf den Kopf, wie das Team in „Current Biology“ berichtet. |
| 2025-07-10 | scinexx | Zoologie | Wie Pythons ihre Beute im Ganzen verdauen Knochenjob im Schlangendarm: Pythons verschlingen ihre Beute am Stück – mitsamt Knochen. Doch wie gelingt es ihnen, ein komplettes Skelett nicht nur zu zerkleinern, sondern vollständig zu verdauen? Die Antwort liefert nun ein neu entdeckter Zelltyp im Darm der Pythons. Dieser hilft den Schlangen dabei, Knochen zu verdauen, und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie keine Calcium-Überdosis erleiden. Solche „Knochenfresser-Zellen“ könnten auch in anderen Raubtieren vorkommen. |
| 2025-07-03 | VBIO | Biologie | Wie Quallen schwimmen Von den biophysikalischen Eigenschaften der einzelnen Zellen bis zur Bewegung des gesamten Körpers - Studie der Humboldt-Universität zu Berlin erklärt, wie Quallen ihre Fortbewegung steuern. Wassertiere benötigen präzise koordinierte Bewegungen, um sich effizient durch offene Gewässer zu bewegen. Quallen, die vorwärts schwimmen, indem sie ihren Schirm zusammenziehen und Wasser ausstoßen, müssen außerdem auf Sinnesreize an der Außenhaut ihres glockenförmigen Körpers reagieren, um Jagd oder Flucht einzuleiten. Wie sie ihre einfachen Nervennetze zur Muskelaktivierung nutzen, ist bisher nicht genau verstanden. |
| 2025-06-25 | scinexx | Evolution | Hundert Jahre altes Rätsel der Evolution gelöst Wie und wann Säugetiere ihre aufrechte Körperhaltung entwickelten Vom Boden in die Höhe: Anders als bei vielen Reptilien stehen die Beine von Säugetieren unter dem Körper statt seitlich – erst dies macht Hund, Pferd und Co zu effizienten Läufern. Doch wie und wann dieser tiefgreifende Wandel der Körperhaltung stattfand, ist seit hundert Jahren eines der großen Rätsel der Paläontologie. Jetzt liefert eine neue Studie überraschende Antworten – und wirft gängige Vorstellungen zum Gang der Säugetiere über Bord. |
| 2025-05-19 | scinexx | Paläontologie | Urahn der Lachse entdeckt Ein in Alaska entdecktes Fossil hat sich als ältester bekannter Urahn der Lachse entpuppt. Dieser Ur-Salmonide namens Sivulliusalmo alaskensis lebte bereits vor 73 Millionen Jahren und war damit ein Zeitgenosse der Dinosaurier. Der neue Fossilfund liefert auch neue Erkenntnisse über die Ursprünge der Lachse. Demnach könnte das kreidezeitliche Polargebiet ein evolutionärer „Schmelztiegel“ für diese Fischgruppe gewesen sein, wie Paläontologen berichten. |
| 2025-05-15 | scinexx | Paläontologie | Neues Fossil des Archaeopteryx enthüllt Ikonische Einblicke: Ein 14. Exemplar des berühmten Archaeopteryx enthüllt nie zuvor gesehene Details des ikonischen Urvogels. So zeigt das „Chicagoer“ Archaeopteryx-Fossil erstmals eine Gruppe von Flügelfedern, die eine entscheidende Anpassung ans Fliegen waren – und die bei anderen gefiederten Dinosauriern fehlten. Die Füße des Urvogel-Fossils liefern Hinweise auf eine teils bodenlebende Lebensweise und sein gut erhaltener Schädel zeigt erste vogelähnliche Gaumenmerkmale, wie Paläontologen in “Nature“ berichten. |
| 2025-04-30 | scinexx | Evolution | Evolution der Kloakentiere geklärt? Anders als lange angenommen war der gemeinsame Vorfahre der heutigen Schnabeltiere und Ameisenigel offenbar nicht landlebend. Stattdessen gingen alle heutigen Kloakentiere aus einem wasserlebenden, grabenden Ursäuger hervor. Das legen Analysen eines fossilen Ursäugers nahe, der zur Zeit der Dinosaurier in Australien lebte. |
| 2025-04-17 | scinexx | Paläontologie | Älteste Ameise der Welt entdeckt In Brasilien haben Paläontologen die älteste fossile Ameise der Welt entdeckt. Die Art mit Namen Vulcanidris cratensis lebte in der mittleren Kreidezeit vor 113 Millionen Jahren und zeichnete sich durch bizarre Mundwerkzeuge für den Beutefang aus. |
| 2025-04-03 | VBIO | Biologie | Jodelnde Affen: Die überraschende Stimmlage von Neuweltaffen Eine aktuelle Studie liefert neue Erkenntnisse über die stimmlichen Fähigkeiten von Neuweltaffen, der Gruppe aller ursprünglichen Primaten des amerikanischen Kontinents: Sie können einen Frequenzsprung erzeugen, der dem menschlichen Jodeln ähnelt, aber einen viel größeren Frequenzbereich abdeckt. |
| 2025-04-03 | scinexx | Paläontologie | Massengrab riesiger Amphibien entdeckt - Die alligatorgroßen Tiere starben vor 230 Millionen Jahren Friedhof der Amphibien: Im US-Bundesstaat Wyoming haben Paläontologen das 230 Millionen Jahre alte Massengrab riesiger Amphibien freigelegt – sie waren so groß wie ein ausgewachsener Alligator. 19 Individuen der Spezies Buettnererpeton bakeri kamen dort einst zu Tode. Aber wie? Starben sie gemeinsam oder sind sie von der Strömung einzeln zu ihrer letzten Ruhestätte getrieben worden? Eine Spurensuche in der Urzeit bringt nun Klarheit. |
| 2025-03-20 | scinexx | Evolution | Hatte der Mensch zwei Gründerpopulationen? Überraschende Entdeckung: Unsere menschliche Spezies könnte durch die Wiedervereinigung von zwei verschiedenen Frühmenschen-Populationen entstanden sein. Ihr Erbgut findet sich heute im Verhältnis 80 zu 20 in unserem Genom, wie in „Nature“ veröffentlichte DNA-Analysen enthüllen. Demnach trennten sich diese Gründerpopulationen vor rund 1,5 Millionen Jahren voneinander, kamen aber vor 300.000 Jahren wieder zusammen – und schufen den Homo sapiens. Doch wer waren diese Gründer? |
| 2025-03-19 | scinexx | Genetik | Die Kubataube bildet eine einzigartige evolutionäre Linie Genetische Rarität: Die in der Karibik heimische Kubataube hat sich überraschend als genetisches Unikat herausgestellt. Sie besitzt keine nahen modernen Verwandten und könnte sich bereits vor 50 Millionen Jahren als eigene Linie vom Stammbaum der Tauben abgespalten haben, wie Wissenschaftler durch Genanalysen herausgefunden haben. Damit ähnelt sie in vielerlei Hinsicht dem einst auf Mauritius heimischen Dodo. Wie er könnte die Kubataube jedoch auf das Aussterben zusteuern.? |
| 2025-02-20 | scinexx | Evolution | Australien: Fundgrube neuer Raubdinosaurier In Australien haben Paläontologen die Fossilien von gleich drei neuen Raubdinosauriern in einem Gebiet entdeckt. Dazu gehören der älteste bekannte Fund eines sechs bis sieben Meter langen Megaraptors, der erste australische Carcharodontosaurier und ein kleiner, vogelähnlicher Raptor. Diese Funde werfen nun ein ganz neues Licht auf die Evolution australischer Raubdinosaurier und auf deren Position in der Nahrungskette, wie das Team berichtet. |
| 2025-02-20 | VBIO | Biologie | Neues Portal „Pilze Deutschlands“ Das neue Portal startet mit 4,3 Millionen Datensätzen zu 12.000 Arten und Unterarten. Es enthält Nachweisdaten zu in Deutschland heimischen Pilzen, darunter die bekannten Speisepilze, aber auch zu wenig bekannten und mikroskopisch kleinen Arten. |
| 2025-01-17 | VBIO | Genetik | Meer Arten? Genetische Unterschiede bei Blauwal-Populationen entdeckt Ein Forschungsteam hat faszinierende genetische Erkenntnisse zur Evolution des größten Tieres der Erde, des ikonischen Blauwals (Balaenoptera musculus), gewonnen. Ihre Studie liefert Hinweise darauf, dass Blauwale aus dem Nordpazifik und Nordatlantik möglicherweise getrennte Unterarten bilden. Schutzmaßnahmen sollten gezielt auf die individuellen Populationen angepasst werden, so das Forschungsteam des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums (SBiK-F) und der Goethe-Universität Frankfurt. |
| 2025-01-13 | VBIO | Biologie | Die giftigste Spinne der Welt besteht aus drei Arten Die Sydney-Trichternetzspinne (Atrax robustus) zählt zu den giftigsten Spinnen der Welt. Allerdings ist diese Spinne nicht eine Art, sondern ein Komplex aus drei Arten. Darunter ist auch eine bislang unbekannte Art, wie ein internationales Team von Forschenden des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels, der Universität Hamburg und Forschungseinrichtungen aus Australien herausgefunden hat. Für die Giftforschung und die Herstellung von Gegengiften ist dies eine wichtige Erkenntnis, denn Spinnengift ist artspezifisch. |
| 2025-01-10 | VBIO | Evolution | Schimpansen: Malariaresistenz und Lebensraumanpassung Schimpansen verfügen über genetische Anpassungen, die ihnen helfen, in unterschiedlichen Wald- und Savannenlebensräumen zu überleben. Ein internationales Forschungsteam unter Federführung des University College London (UCL) zeigt, dass einige dieser Anpassungen die Tiere auch vor Malaria schützen könnten. Die Forschenden betonen, dass ihre Ergebnisse Einblicke in unsere eigene Evolutionsgeschichte geben, sowie in die Biologie der Malariainfektion beim Menschen. |
| 2024-12-30 | scinexx | Evolution | Wie der genetische Code entstand Erste Lebewesen könnten andere Aminosäuren in der DNA kodiert haben. Ursprung des Gencodes: Die Basenabfolge unserer DNA kodiert die Bauanleitungen für Proteine über die Abfolge ihrer Grundbausteine, der Aminosäuren. Doch der genetische Code für diese Proteinbausteine könnte zu Beginn des Lebens anders ausgesehen haben als heute, wie neue Analysen nahelegen. Der heutige DNA-Code war demnach nicht der erste Code des Lebens. Zudem fanden einige Aminosäuren früher als gedacht Einzug in den Gencode, andere später. |
| 2024-12-17 | VBIO | Paläontologie | Paläontologen stellen den weltweit ältesten Vorfahren der Säugetiere vor Ein internationales Forscherteam, darunter Dr. Eudald Mujal, Paläontologe am Naturkundemuseum Stuttgart, hat ein fossiles Tier beschrieben, das vor etwa 280 bis 270 Millionen Jahren auf dem heutigen Mallorca lebte und zu einer Gruppe von Säbelzahntieren gehörte. Der Fund ist nicht nur wegen der Menge der gefundenen Überreste bemerkenswert, sondern auch, weil es sich um die Fossilien des ältesten bekannten Gorgonopsier der Erde handelt. Die Gorgonopsier gehören zu der Entwicklungslinie, aus der später die ersten Säugetiere hervorgingen. |
| 2024-11-27 | scinexx | Biochemie | Giftrezept des Steinfischs entschlüsselt Wissenschaftler haben erstmals auch die kleinen Moleküle im Gift von Steinfischen analysiert – den giftigsten Fischen der Welt. Badegäste kommen mit dem schmerzhaften Gift der am Meeresboden lebenden Tiere in Kontakt, wenn sie aus Versehen auf deren Rückenstacheln treten. Die neue Zutatenanalyse könnte nun einige der typischen Symptome erklären, die Betroffene dabei erleben. |
| 2024-11-22 | VBIO | Paläontologie | Mit Biss: Weltweit größtes Doppelschleichen-Fossil entdeckt Ein internationales Forschungsteam hat eine neue fossile Doppelschleichen-Art in Tunesien entdeckt. Terastiodontosaurus marcelosanchezi ist mit über fünf Zentimetern Schädellänge die größte bekannte Art aus der Gruppe der Amphisbaenia. Anders als heutige, meist unterirdisch lebende Doppelschleichen könnte diese Art auch an der Erdoberfläche gelebt haben. Das Fossil zeigt extreme Zahnmerkmale, darunter kräftige Kiefer und speziellen Zahnschmelz, die auf den Verzehr von Schnecken hindeuten – eine Ernährungsweise, die sich seit über 56 Millionen Jahren gehalten hat. |
| 2024-11-04 | VBIO | Genetik | Erbgut des Auerochsen entschlüsselt Forschende bestimmen das Genom aller Unterarten des ausgestorbenen Auerochsen und zeigen die Geschichte ihrer Entwicklung bis zum Hausrind. Die Ergebnisse einer internationalen Studie beschreiben die genetische Entwicklung des Auerochsen (Bos primigenius), des wilden Vorfahren des Hausrindes, während und nach der Eiszeit. Die mitteleuropäische Unterart wurde dabei durch Gen-Sequenzierungen bestimmt |
| 2024-10-31 | scinexx | Paläontologie | Älteste Kaulquappe der Welt entdeckt Spektakulärer Fund: In Argentinien haben Paläontologen die älteste fossile Kaulquappe der Welt entdeckt. Die Froschlarve stammt aus der Zeit vor 161 Millionen Jahren und lebte damit zeitgleich mit den Dinosauriern. Sie belegt, dass Frösche auch damals schon eine Metamorphose vom rein aquatischen Jugendstadium zum landlebenden Frosch durchlebten. Gleichzeitig ist das Fossil der erste Larvenfund für urtümliche Froschlurche, wie das Team in „Nature“ berichtet. Dennoch ähnelt die Larve heutigen Kaulquappen schon sehr. |
| 2024-10-17 | scinexx | Biologie | Wie „intelligent“ sind Pilze? Kluge Netzwerker: Pilze haben kein Gehirn, zeigen aber dennoch Anzeichen von einfacher Intelligenz. Sie erkennen beispielsweise Muster und Anordnung von Nahrungsquellen in ihrer Umgebung und richten ihre Mycelfäden danach aus, wie Forschende herausgefunden haben. Demnach verarbeiten Pilze mithilfe ihres Mycels Informationen über ihre Umgebung und treffen bei ihrem Wachstum passende Entscheidungen – ein Zeichen für „basale Kognition“. |
| 2024-10-16 | Forschung und Wissen | Biologie | Neues Ökosystem in Höhlen in der Tiefsee entdeckt Hydrothermalquellen, darunter das kürzlich entdeckte, 300 Grad Celsius heiße Jøtul-Hydrothermalfeld in arktischen Tiefsee, bilden Ökosysteme, in denen viele speziell angepasste Tierarten leben. Es ist zudem seit Langem bekannt, dass sich rund um Hydrothermalquellen viele kleine Höhlen befinden, die die Wissenschaft bisher aber kaum untersucht hat. Forscher der Universität Wien haben nun mit dem Schiff Falkor (too) des Schmidt Ocean Institute während einer 30-tägigen Expedition Höhlen am Ostpazifischen Rücken vor Mittelamerika in rund 2.500 Metern Tiefe untersucht. |
| 2024-09-17 | scinexx | Paläontologie | Urzeit-Pandabär im Allgäu entdeckt Im Allgäu haben Paläontologen die 11,5 Millionen Jahre alten Überreste eines Pandabären entdeckt – des ältesten Verwandten der asiatischen Großen Pandas. Das Fossil ist der erste Nachweis eines Kretzoiarctos beatrix nördlich der Iberischen Halbinsel und der erste Fund dieser Art in Mitteleuropa. Zahnanalysen des Fossils verraten, dass dieser europäische Ur-Panda offenbar noch nicht auf Bambus und ähnlich harte Pflanzennahrung spezialisiert war. Stattdessen ernährte er sich ähnlich wie die heutigen Braunbären. |
| 2024-09-13 | scinexx | Verhaltensforschung | Geheimnisse der „Taucher-Eidechse“ gelüftet Kleiner Tauchprofi: Droht Gefahr, dann taucht die semiaquatische Eidechse „Anolis aquaticus“ einfach ab und bleibt bis zu 20 Minuten lang unter Wasser. Wie ihr das gelingt, war bis jetzt allerdings unklar. Zwar bezieht das Reptil während seiner Tauchgänge Sauerstoff aus einer Luftblase an der Schnauze, doch wie essenziell dieses Bläschen tatsächlich für die Unterwasseratmung ist, hat eine Biologin erst jetzt herausgefunden. |