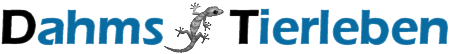Systematik der Squamata
Mit rund 11.000 Arten stellen die Schuppenkriechtiere einen erheblichen Teil der Landwirbeltiere. Etwa 96% aller rezenten Reptilienarten zählen zu den Schuppenkriechtieren. Die Benennung beschreibt die Beschuppung der Epidermis (= der Oberhaut). Sie dient als Schutzschild gegen infektiöse Erreger und schützt vor Austrocknung. Reptilien wachsen lebenslang. Da die Epidermis nicht mit wächst, wird sie regelmäßig erneuert. Nachdem eine neue Epidermis gewachsen ist, wird die alte Haut abgestreift, bei vielen Echsen in Fetzen. Schlangen streifen die Haut oft im Ganzen ab. Viele Geckos fressen sie unmittelbar nach der Häutung auf.
Die Struktur der Schuppenkriechtiere basiert auf The phylogeny of squamate reptiles (lizards, snakes, and amphisbaenians) inferred from nine nuclear protein-coding genes [Nicolas Vidal & Blair Hedges, 2005].
Als erste Gruppe sind die Schlangenschleichen (Dibamia) gelistet. Sie haben als einzige Schuppenkriechtiere eine einspitzige Zunge.
Alle anderen Schuppenkriechtiere werden in das Taxon Bifurcata gestellt. Diese haben eine in unterschiedlichem Ausmaß ausgeprägt zweispitzige Zunge.
Die Bifurcata teilen sich in die Geckoartigen, deren Schlüpflinge einen paarigen Eizahn besitzen, und die Unidentata, die nur einen Eizahn haben.
Innerhalb der Unidentata werden Scincomorpha und Episquamata unterschieden. Zu den Scincomorpha gehören Skinke, Gürtelechsen, Schildechsen und Nachtechsen. Die Episquamata setzen sich zusammen aus Laterata mit Zwergtejus und Schienenechsen und Toxicofera.
Zu den Toxicofera gehören die Schlangen, die Leguanartigen und die Schleichenartigen. Die Fähigkeit Toxine (=Gift) zu erzeugen, wurde nur einmal im Verlauf der Stammesgeschichte entwickelt. Der gemeinsame Vorfahre aller Toxicofera soll vor etwa 230 bis 200 Millionen Jahren gelebt haben.
Dibamia (Schlangenschleichenähnliche Kriechtiere) [GASC, 1968]
-
Dibamidae (Schlangenschleichen) [BOULENGER, 1884]
Schlangenschleichen sind kleine, beinlose und wurmförmige Schuppenkriechtiere. Die Männchen haben stummelartige Hinterbeine, mit denen sie sich bei der Paarung an den Weibchen festhalten. Es sind zwei Gattungen beschrieben, Anelytropsis aus Mexiko und Dibamus aus Südostasien. Schlangenschleichen sind die einzigen Schuppenkriechtiere mit einer einspitzigen Zunge.
Bifurcata (Gabelzungenkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]
Bifurcata haben im Unterschied zu Dibamia eine zweispitzige Zunge. Das gilt allerdings nicht für die Chamäleons, deren Zunge sekundär zu einem hochspezialisierten Fangapparat umgebildet ist.
Gekkota (Geckoartige) [CUVIER, 1817]
Die Geckoartigen haben zahlreiche Besonderheiten. Ihre Lautäußerungen unterscheiden sich von Art zu Art. Der Tokeh (Gekko gecko) ist für seine sehr lauten Paarungsrufe bekannt. Die meisten Geckos der Familie Gekkonidae benutzen zwitschernde oder klickende Laute für ihre sozialen Interaktionen. Andere Arten sind in der Lage, zischende Geräusche von sich zu geben, wenn sie bedroht werden. Alle Geckos, mit Ausnahme der Arten der Familie Eublepharidae, haben keine Augenlider. Stattdessen besteht die Außenfläche des Augapfels aus einer durchsichtigen Membran, der Hornhaut. Sie haben eine feste Linse in jeder Iris, die sich bei Dunkelheit vergrößert, um mehr Licht durchzulassen. Da sie nicht blinzeln können, lecken Arten ohne Augenlider im Allgemeinen ihre Hornhaut ab, um sie von Staub und Schmutz zu befreien und sie sauber und feucht zu halten. Viele Arten sind für ihre spezialisierten Zehenballen bekannt, mit denen sie sich auf glatten Oberflächen und an der Zimmerdecke fortbewegen können. Es sind zwei Gruppen mit insgesamt sieben Familien und ca. 1.600 Arten beschrieben.
-
Pygopodomorpha (Flossenfußartige) [VIDAL & HEDGES, 2005]
- Familie Carphodactylidae (Australische Geckos) [KLUGE, 1987]
- Familie Diplodactylidae (Doppelfingergeckos) [KLUGE, 1967]

- Familie Pygopodidae (Flossenfüße) [BOULENGER, 1884]
-
Gekkomorpha [VIDAL & HEDGES, 2005]
- Familie Eublepharidae (Lidgeckos) [BOULENGER, 1883]

- Familie Gekkonidae (Eigentliche Geckos) [GRAY, 1825]

- Familie Phyllodactylidae (Blattfingergeckos) [GAMBLE, BAUER, GREENBAUM & JACKMAN, 2008]

- Familie Sphaerodactylidae (Kugelfingergeckos) [UNDERWOOD, 1954
 ]
]
- Familie Eublepharidae (Lidgeckos) [BOULENGER, 1883]
Unidentata (Einzahnkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]
Unidentata enthält Episquamata und Scinciformata und bezieht sich auf das Vorhandensein eines Eizahns, während die Geckoartigen einen paarigen Eizahn besitzen.
-
Scincomorpha oder Scincoidea (Skinkartige) [CAMP, 1923]
- Familie Scincidae (Skinke) [GRAY, 1825]
- Unterfamilie Acontinae (Lanzenskinke) [GRAY, 1839]
- Unterfamilie Egerniinae [WELCH, 1982]

- Unterfamilie Eugongylinae [WELCH, 1982]
- Unterfamilie Lygosominae [MITTLEMAN, 1952]

- Unterfamilie Mabuyinae [MITTLEMAN, 1952]

- Unterfamilie Ristellinae [HEDGES, 2014]
- Unterfamilie Scincinae [GRAY, 1825], inkl. Ateuchosaurus

- Unterfamilie Sphenomorphinae [WELCH, 1982]
-
Cordylomorpha (Gürtelechsenartige) [VIDAL & HEDGES, 2005]
- Familie Cordylidae (Gürtelschweife oder Gürtelechsen) [MERTENS, 1937]

- Familie Gerrhosauridae (Schildechsen) [FITZINGER, 1843]

- Familie Xantusiidae (Nachtechsen) [BAIRD, 1858]
- Familie Cordylidae (Gürtelschweife oder Gürtelechsen) [MERTENS, 1937]
- Familie Scincidae (Skinke) [GRAY, 1825]
-
Episquamata (Höhere Schuppenkriechtiere) [VIDAL & HEDGES, 2005]
-
Laterata (Fliesenschuppenträger) [VIDAL & HEDGES, 2005]
Die Bezeichnung bezieht sich auf das Vorhandensein von fliesenartigen (quadratischen oder viereckigen) Schuppen.-
Gymnophthalmoidea [FITZINGER, 1826] oder Teiformata [VIDAL & HEDGES, 2005]
- Familie Alopoglossidae [PELLEGRINO, RODRIGUES, YONENAGA-YASSUDA & SITES, 2001]
- Familie Gymnophthalmidae (Zwergtejus) [MERREM, 1820]
- Familie Teiidae (Schienenechsen) [GRAY, 1827]

-
Lacertibaenia [VIDAL & HEDGES, 2005]
Lacertibaenia ist ein Kunstwort, das die Lacertiformata und die Amphisbaenia zusammenfasst.-
Lacertiformata [VIDAL & HEDGES, 2005]
- Familie Lacertidae (Echte Eidechsen) [OPPEL, 1811]

- Familie Lacertidae (Echte Eidechsen) [OPPEL, 1811]
-
Amphisbaenia (Doppelschleichen) [GRAY, 1844]
- Familie Amphisbaenidae (Eigentliche Doppelschleichen) [GRAY, 1865]
- Familie Bipedidae (Zweifuß-Doppelschleichen) [TAYLOR, 1951]
- Familie Blanidae [KEARNEY & STUART, 2004]
- Familie Cadeidae [VIDAL & HEDGES, 2007]
- Familie Rhineuridae (Florida-Doppelschleichen) [VANZOLINI, 1951]
- Familie Trogonophidae (Spitzschwanz-Doppelschleichen) [GRAY, 1865]
-
Lacertiformata [VIDAL & HEDGES, 2005]
-
Gymnophthalmoidea [FITZINGER, 1826] oder Teiformata [VIDAL & HEDGES, 2005]
-
Toxicofera (Giftdrüsenträger) [VIDAL & HEDGES, 2005]
Zur Gruppe der Toxicofera (toxine = „Gift“, ferre = „tragen“) zählen Schlangen, Schleichenartige und Leguanartige. Der gemeinsame Vorfahre aller Toxicofera soll vor etwa 230 bis 200 Millionen Jahren gelebt haben. Lange Zeit galten nur die Giftnattern, die Vipern, die Trugnattern und die Krustenechsen (Heloderma) als giftige Schuppenkriechtiere. Inzwischen wurde in Ober- und Unterkiefer der Östlichen Bartagame (Pogona barbata), giftproduzierendes Drüsengewebe gefunden. Außerdem werden Symptome, die nach den Bissen von Komodowaran, Buntwaran und Gebändertem Baumwaran auftreten, nicht mehr nur als Ergebnis einer Bakterieninfektion, sondern als Resultat einer aktiven Giftsekretion interpretiert. Beim Komodowaran konnten Giftdrüsen mit Hilfe von 3D-Scans eines Schädels in einem Magnetresonanztomographen nachgewiesen werden. Hinweise auf Giftdrüsen gibt es zudem bei fossilen Schleichenartigen. Heute gehören knapp 60% Schuppenkriechtierarten zu den Toxicofera.
-
Serpentes (Schlangen) [LINNAEUS, 1758]
- Überfamilie Acrochordoidea (Warzenschlangenverwandte) [BONAPARTE, 1831]
- Familie Acrochordidae (Warzenschlangen) [BONAPARTE, 1831]

- Familie Acrochordidae (Warzenschlangen) [BONAPARTE, 1831]
- Überfamilie Uropeltoidea [MÜLLER, 1832]
- Familie Anomochilidae (Wühlschlangen) [CUNDALL, WALLACH & ROSSMAN, 1993]
- Familie Cylindrophiidae (Walzenschlangen) [FITZINGER, 1843]
- Familie Uropeltidae (Schildschwänze) [MÜLLER, 1832]
- Überfamilie Pythonoidea (Pythonartige) [FITZINGER, 1826]
- Familie Loxocemidae (Spitzkopfpythons) [COPE, 1861]
- Familie Pythonidae (Pythons) [FITZINGER, 1826]

- Familie Xenopeltidae (Erdschlangen) [BONAPARTE, 1845]
- Überfamilie Booidea (Boaartige) [GRAY, 1825]
- Familie Boidae (Riesenschlangen) [GRAY, 1825]

- Überfamilie Colubroidea (Nattern- und Vipernverwandte) [OPPEL, 1811]
- Familie Colubridae (Nattern) [OPPEL, 1811]
- Unterfamilie Calamariinae (Zwergschlangen) [BONAPARTE, 1838]
- Unterfamilie Chrysopeleinae [COPE, 1893] (früher Ahaetuliinae)

- Unterfamilie Colubrinae (Eigentliche Nattern) [OPPEL, 1811]

- Unterfamilie Dipsadinae (Schneckennattern) [BONAPARTE, 1838]

- Unterfamilie Grayiinae [MEIRTE, 1992]
- Unterfamilie Natricinae (Wassernattern) [BONAPARTE, 1838]

- Unterfamilie Pseudoxenodontinae [MCDOWELL, 1987]
- Unterfamilie Sibynophiinae [DUNN, 1928]
- incertae sedis (Arten, die keiner Unterfamilie innerhalb der Familie Colubridae zugeordnet sind)
- Überfamilie Elapoidea
- Familie Atractaspididae (Erdvipern) [GÜNTHER, 1858]
- Familie Cyclocoridae [WEINELL & BROWN, 2017]
- Familie Elapidae (Giftnattern) [BOIE, 1827]

- Familie Lamprophiidae (Hausnattern) [FITZINGER, 1843]

- Familie Micrelapidae [DAS, GREENBAUM, MEIRI, BAUER, BURBRINK, RAXWORTHY, WEINELLBROWN, BRECKO, PAUWELS, RABIBISOA, RASELIMANANA, MERILÄ, 2023]
- Familie Prosymnidae [KELLY, BARKER, VILLET & BROADLEY, 2009]
- Familie Psammodynastidae [DAS, GREENBAUM, BRECKO, PAUWELS, RUANE, PIRRO & MERILÄ, 2024]

- Familie Psammophiidae [BONAPARTE, 1845]
- Familie Pseudaspididae [DOWLING & DUELLMAN, 1978]
- Familie Pseudoxyrhophiidae [DOWLING, 1975]
- incertae sedis (Arten, die keiner Familie innerhalb der Überfamilie Elapoidea zugeordnet sind)
- Überfamilie Scolecophidia (Blindschlangenartige) [COPE, 1864]
- Familie Anomalepididae (Amerikanische Blindschlangen) [TAYLOR, 1939]
- Familie Gerrhopilidae [VIDAL, WYNN, DONNELLAN & HEDGES, 2010]
- Familie Leptotyphlopidae (Schlankblindschlangen) [STEJNEGER, 1892]
- Familie Typhlopidae (Blindschlangen) [MERREM, 1820]
- Familie Xenotyphlopidae (Madagaskar Blindschlangen) [VIDAL, VENCES, BRANCH & HEDGES, 2010]
- Aktuell nicht zu einer Überfamilie zugeordnet:
- Familie Aniliidae (Rollschlangen) [STEJNEGER, 1907]
- Familie Bolyeriidae (Boylerschlangen) [HOFFSTETTER, 1946]
- Familie Homalopsidae (Wassertrugnattern) [GÜNTHER, 1864]

- Familie Pareidae (Asiatische Schneckennattern) [ROMER, 1956]
- Familie Tropidophiidae (Erdboas) [BRONGERSMA, 1951]
- Familie Viperidae (Vipern) [OPPEL, 1811]

- Familie Xenodermidae (Höckernattern) [GRAY, 1849]
- Familie Xenophidiidae (Stachelkieferschlangen) [WALLACH & GÜNTHER, 1998]
- Überfamilie Acrochordoidea (Warzenschlangenverwandte) [BONAPARTE, 1831]
-
Iguania (Leguanartige) [COPE, 1864]
Die Leguanartigen werden in zwei größeren Gruppen strukturiert. Agamen und Chamäleons werden im Taxon Acrodonta zusammengefaßt. Ihre Zähne sind auf der Oberkante des Kiefers befestigt. Alle anderen Leguanartigen bilden die Gruppe Pleurodonta. Ihre Zähne sitzen wurzellos an der Innenkante der Kiefer.-
Acrodonta [Cope, 1864]
- Familie Agamidae (Agamen) [GRAY, 1827]

Agamen kommen in Europa, Afrika, Asien und Australien vor. Sie zeigen eine erstaunliche Formen- und Verhaltensvielfalt. Sie bewohnen trockene Wüsten, Steppen und Wälder. Flugdrachen der Gattung Draco können von einem Baum zum anderen gleiten, Dornteufel (Moloch horridus) haben ein System aus mikroskopischen Rillen in ihrer Haut, um Wasser aus Regenfällen oder die Feuchtigkeit aus dem Nebel zum Maul zu transportieren. Agamen haben exzellente Augen und ein gutes Gehör. Der Geruchssinn ist trotz des Vorhandenseins von Riechzellen im Nasengang und dem Jacobson-Organ nicht stark entwickelt. - Familie Chamaeleonidae (Chamäleons) [RAFINESQUE, 1815]

Auffällige Merkmale der Chamäleons sind der gedrungener Rumpf, der hohe Rücken und der kompakte Schädel, die unabhängig voneinander bewegbaren Augen, die Greifhände, die zur Jagd einsetzbare lange Zunge und die Farbwechselfähigkeit. Der Farbwechsel dient in erster Linie zur Kommunikation mit den Artgenossen. Auch äußere Faktoren (Temperatur, Sonneneinstrahlung oder Luftfeuchtigkeit) wirken sich auf das Erscheinungsbild aus. Mehr als 200 Arten sind beschrieben, davon kommen 40% ausschließlich auf Madagaskar vor. Die artenreichste Gruppe sind die Echten Chamäleons (Chamaeleoninae). Sie sind i.d.R. größer, haben einen langen Schwanz und eine stark ausgeprägte Farbwechselfähigkeit. Die zweite Gruppe bilden die Stummelschwanzchamäleons (Brookesiinae). Sie sind recht klein, haben nur einen rudimentären Schwanz, sind eher unauffällig gefärbt und weisen auch nur eine geringe Farbwechselfähigkeit auf.
- Familie Agamidae (Agamen) [GRAY, 1827]
-
Pleurodonta [Cope, 1864]
- Familie Anolidae (Anolis) [COCTEAU, 1836]

- Familie Corytophanidae (Basilisken und Helmleguane) [FITZINGER, 1843]

- Familie Crotaphytidae (Halsband- und Leopardleguane) [SMITH & BRODIE, 1982]

- Familie Hoplocercidae (Stachelschwanzleguane) [FROST & ETHERIDGE, 1989]
- Familie Iguanidae (Echte Leguane) [OPPEL, 1811]

- Familie Leiocephalidae (Glattkopfleguane) [FROST & ETHERIDGE, 1989]

- Familie Leiosauridae [FROST, ETHERIDGE, JANIES & TITUS, 2001]
- Familie Liolaemidae [FROST & ETHERIDGE, 1989]

- Familie Opluridae (Madagaskarleguane) [MOODY, 1983]

- Familie Phrynosomatidae (Stachelleguane und Krötenechsen) [FITZINGER, 1843]

- Familie Polychrotidae (Buntleguane) [FITZINGER, 1843]

- Familie Tropiduridae (Kielschwanzleguane) BELL, 1843]

- Familie Anolidae (Anolis) [COCTEAU, 1836]
-
Acrodonta [Cope, 1864]
-
Anguimorpha (Schleichenartige) [FÜRBRINGER, 1900]
Zur Gruppe der Schleichenartigen gehören rund 200 Arten aus 8 Familien. Gemeinsames Merkmal sind die alternierend wachsenden neuen Zähne. Das heißt, die neuen Zähne wachsen zwischen – und nicht unterhalb – der alten Zähne heran. Zudem ist die Zunge der Schleichenartigen durch eine Falte in einen vorderen und hinteren Abschnitt geteilt. Es werden zwei Gruppe unterschieden. Paleoanguimorpha mit Waranen, Taubwaranen und Krokodilschwanzechsen. In der zweiten Gruppe Neoanguimorpha befinden sich Schleichenverwandten, Höckerechsen und Krustenechsen.-
Paleoanguimorpha (Waranartige) [VIDAL & HEDGES, 2009]
-
Shinisauroidea (Krokodilschwanzechsenverwandte) [AHL, 1930]
- Familie Shinisauridae (Krokodilschwanzechsen) [AHL, 1930]

Diese semi-aquatische Echsen sind sehr selten geworden. Es gibt zwei Populationen, eine in China (Unterart Shinisaurus crocodilurus crocodilurus) und eine zweite in Vietnam (Unterart Shinisaurus crocodilurus vietnamensis). Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit in seichtem Wasser oder in überhängenden Ästen und Vegetation, wo sie ihre Beute aus Insekten, Schnecken, Kaulquappen und Würmern jagen. Die an ein Krokodil erinnernde Beschuppung des Schwanzes ist für die Benennung dieser Art verantwortlich.
- Familie Shinisauridae (Krokodilschwanzechsen) [AHL, 1930]
-
Varanoidea (Waranverwandte) [MÜNSTER, 1834]
- Familie Lanthanotidae (Taubwarane) [STEINDACHNER, 1877]
Der Borneo-Taubwaran (Lanthanotus borneensis) ist der einzige Vertreter der Familie Lanthanotidae. Über die Lebensweise von Taubwaranen ist wenig bekannt. Die lichtscheuen Tiere verbringen die meiste Zeit in unterirdischen Gängen bzw. Höhlen, unter Pflanzen oder im Wasser und sind wohl nachtaktiv. Die Nasenlöcher sind weit nach hinten verschobenen, was für eine bessere Atmung beim Schwimmen sorgt. Das Augenlid ist nicht wasserdurchlässig, dadurch können Taubwarane beim Tauchen sehen. Eine äußere Ohröffnung fehlt, sie sind nahezu gehörlos. Es gibt Vermutungen, dass sich die Schlangen aus aus taubwaranähnlichen Reptilien entwickelt haben.
- Familie Varanidae (Warane) [MERREM, 1820]

- Familie Lanthanotidae (Taubwarane) [STEINDACHNER, 1877]
-
Shinisauroidea (Krokodilschwanzechsenverwandte) [AHL, 1930]
-
Neoanguimorpha (Echte Schleichenartige) [VIDAL & HEDGES, 2009]
- Familie Helodermatidae (Krustenechsen) [GRAY, 1837]

Das bevorzugte Nahrungsspektrum der Krustenechsen besteht aus Kleinsäugern, Nagern und Vögeln. Lange Zeit galten die sie als die einzigen giftigen Echsen. Inzwischen wurden Gifte auch bei anderen Arten, z.B. den Komodowaranen nachgewiesen. Krustenechsen setzen ihr Gift selten bei der Jagd ein, sondern eher bei ihrer Verteidigung. -
Diploglossa (Schleichenartige) [COPE, 1864]
-
Xenosauroidea (Höckerechsenverwandte) [COPE, 1866]
- Familie Xenosauridae (Höckerechsen) [COPE, 1866]
-
Anguioidea (Schleichenverwandte) [OPPEL, 1811]
- Familie Anguidae (Schleichen) [GRAY, 1825]
- Familie Anniellidae (Ringelschleichen) [BOULENGER, 1885]
- Familie Diploglossidae (Doppelzungenschleichen) [BOCOURT, 1873]
-
Xenosauroidea (Höckerechsenverwandte) [COPE, 1866]
- Familie Helodermatidae (Krustenechsen) [GRAY, 1837]
-
Paleoanguimorpha (Waranartige) [VIDAL & HEDGES, 2009]
-
Laterata (Fliesenschuppenträger) [VIDAL & HEDGES, 2005]
Die Kapitel zur Systematik
- Grundlagen der Systematik - Begriffe und Strukturelemente
- Lebewesen - Die Systematik der Lebewesen
-
Metazoa - Die Systematik der Vielzelligen Tiere
-
Nephrozoa - Die Systematik der Nierentiere
-
Vertebrata - Die Systematik der Wirbeltiere
-
Tetrapoda - Die Systematik der Landwirbeltiere
- Squamata - Die Systematik der Schuppenkriechtiere
-
Tetrapoda - Die Systematik der Landwirbeltiere
-
Vertebrata - Die Systematik der Wirbeltiere
-
Nephrozoa - Die Systematik der Nierentiere